
Der Bestseller-Autor habe offenbar weder die Wissenschaft verstanden noch die Religion, kritisiert ausgerechnet der Professor, dessen Doppelgänger der Held des neuesten Brown-Buchs ist.
WASHINGTON, – Der prominente Wissenschaftler Jeremy England sagt, er ist „enttäuscht“ darüber, wie ihn der Autor des „Da Vinci Codes“, Dan Brown, in seinem neuen Buch „Origin“ literarisch darstellt und betont: Der Schriftsteller „kann mich nicht zitieren, um Gott zu leugnen.“
Jeremy England, Doktor der Physik an der Stanford University, arbeitet als Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT), eine der führenden Universitäten der Welt. Dan Brown schuf den Charakter Edmond Kirsch für sein Buch „Origin“ und benutzte dafür England und seine Forschungen zum Ursprung des Lebens als Grundlage.
Anlässlich der Vorstellung von „Origin“ bei der Frankfurter Buchmesse versicherte Dan Brown vor Kurzem in einer Erklärung an die Presse, dass er sich durch die Frage, „ob Gott die Wissenschaft überleben werde“ inspirieren ließ.
Im selben Gespräch gab Brown selbst die Antwort: Nein. Und er fragte sich weiter: „Sind wir heute so naiv zu glauben, dass die Götter der Gegenwart überleben werden und dass es sie auch in hundert Jahren noch geben wird?“
Offenbar meinte der Bestseller-Autor das wirklich ernst, denn er fuhr fort, dass „Gott durch eine Art globales Bewusstsein, das wir wahrnehmen, und das sich zu unserer Gottheit entwickeln wird, ersetzt werden“ wird.
Professor England, der sich selbst als orthodoxen Juden betrachtet, sagte in einem Artikel, der von der amerikanischen Tageszeitung Wall Street Journal veröffentlicht wurde, dass „Dan Brown mich nicht zitieren kann, um Gott zu leugnen.“
Der Wissenschaftler bemerkte erst kürzlich, dass Brown seinen „Doppelgänger“ ins Buch aufgenommen hatte und auch wenn England der Meinung ist, dass „die Beschreibung, die Brown von ihm mache, schmeichelhaft ist, so irrt der Schriftsteller doch, was die Bedeutung meiner Forschung angeht.“
„Eine seiner Figuren erklärt, dass mein literarischer Doppelgänger das ‚zugrundeliegende physische Prinzip identifiziert haben könnte, welches den Ursprung und die Evolution des Lebens antreibe.‘ Wenn die Theorie des fiktiven Jeremy England korrekt ist, suggeriert das Buch, wäre das eine transzendentale Widerlegung aller anderen Schöpfungsgeschichten. Alle Religionen könnten obsolet werden“, erläuterte England.
Für den Wissenschaftler des MIT „wäre es ein Leichtes, die Theorien meines fiktiven Ich aufgrund der kurzen Beschreibung von Herrn Brown zu kritisieren, aber es wäre auch ungerecht.“
„Meine echte Forschung darüber, wie lebens-ähnliche Verhaltensweisen in unbelebter Materie entstehen ist offen zugänglich, während die Arbeit der Figur Dan Browns nur vage beschrieben wird.“
Im Buch von Dan Brown „gibt es keine wirkliche Wissenschaft, über die zu diskutieren wäre“, betonte er.
„Meine wirkliche Sorge hat mit der Haltung meines Doppelgängers im Buch zu tun“ präzisierte er, denn er wird dargestellt als „futuristischer Milliardär, dessen Mission es ist, zu beweisen, dass die Wissenschaft Gott irrelevant gemacht hat.“
Der amerikanische Wissenschaftler erklärte, dass „die Sprache der Physik äußerst nützlich sein kann, um über die Welt zu sprechen, aber niemals kann sie alles ansprechen, was über das menschliche Leben gesagt werden muss.“
England führte als Beispiel an, dass „Gleichungen auf elegante Weise erklären, wie sich ein Flugzeug in der Luft halten kann, aber sie können das Staunen eines Menschen, der über den Wolken fliegt, nicht vermitteln.“
„Ich bin enttäuscht von meinem fiktiven Selbst, weil es so vergnügt desinteressiert ist an dem, was jenseits der engen Grenzen des technischen Bereichs liegt“, sagte er.
„Ich bin Wissenschaftler, aber ich studiere auch die hebräische Bibel und lebe nach ihr. Für mich ist die Vorstellung, dass die Physik beweisen könne, dass der Gott Abrahams nicht der Schöpfer und Herrscher der Welt ist, ein schwerwiegendes Missverständnis sowohl der wissenschaftlichen Methode als auch der Funktion des biblischen Textes.“
„Die Wissenschaft ist ein Annäherung an die allgemeine Erfahrung. Sie behandelt das, was objektiv messbar ist, indem sie Modelle erfindet, die die teilweise Vorhersehbarkeit der Welt zusammenfassen“, erklärte er.
„Im Gegensatz dazu sagt der biblische Gott im brennenden Dornbusch zu Mose: ‚Ich bin, der Ich-bin-da‘. Das bezieht sich auf die Ungewissheit, welche die Zukunft für alle darstellt. Keine Vorhersage kann die Frage, was als nächstes passieren wird, vollständig beantworten.“
„Die Menschen werden immer eine Entscheidung darüber treffen müssen, wie sie sich zur unbekannte Zukunft verhalten. Die Begegnungen Gottes mit den jüdischen Propheten werden oft mit Begriffen des Bundes beschrieben, teils auch um hervorzuheben, dass das Erkennen der Hand Gottes, der wirkt, mit einer bewussten Entscheidung beginnt, die Welt auf eine gewisse Weise zu sehen.“
England betonte, dass es „kein wissenschaftliches Argument gebe“ durch das man darauf vertrauen könne, „dass Gott durch die Ereignisse der Welt spricht“, aber „die Wissenschaft kann dies auch auf keinerlei Weise widerlegen, denn das liegt außerhalb der Reichweite ihrer Forschung.“
Für den amerikanischen Wissenschaftler ist „die wichtigste Frage“, ob „wir weiterhin über Gott lernen müssen? Im Licht all dessen, was ich weiß, bin ich mir meinerseits sicher, dass es so ist.“ (CNA Deutsch)
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen...







 Auch Kardinal Gerhard Müller geriet jetzt in den Zielpunkt einer Desinformationskampagne, kommentiert Guido Horst.
Auch Kardinal Gerhard Müller geriet jetzt in den Zielpunkt einer Desinformationskampagne, kommentiert Guido Horst. Der US-amerikanische Anthropologie-Professor David Kertzer tritt mit einer klaren These an. Pius XI., Papst von 1922 bis 1939, hat aus seiner Sicht dem italienischen Faschismus den Weg geebnet und sei über weite Strecken ein Verbündeter Benito Mussolinis gewesen. In seinem Werk „Der erste Stellvertreter. Papst Pius XI. und der geheime Pakt mit dem Faschismus“ vertieft Kertzer diese Einschätzung auf 600 Seiten, ein Drittel davon sind Fußnoten.
Der US-amerikanische Anthropologie-Professor David Kertzer tritt mit einer klaren These an. Pius XI., Papst von 1922 bis 1939, hat aus seiner Sicht dem italienischen Faschismus den Weg geebnet und sei über weite Strecken ein Verbündeter Benito Mussolinis gewesen. In seinem Werk „Der erste Stellvertreter. Papst Pius XI. und der geheime Pakt mit dem Faschismus“ vertieft Kertzer diese Einschätzung auf 600 Seiten, ein Drittel davon sind Fußnoten. Immer noch Überraschungen, neue Fragmente, neue Debatten: Auch siebzig Jahre nach den ersten Funden erregen die Manuskripte von Qumran immer neues Interesse. Es war eine Ziege gewesen, mit der 1947 in der Judäischen Wüste alles angefangen hatte; auf der Suche nach ihr machte ein Hirte in einer Berghöhle nicht weit von Jericho die spektakulärste archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Er fand Schriftrollen aus dem Umfeld der Bibel. Ausgrabungen förderten bis 1956 in elf Höhlen die Überreste von 900 hebräischen Rollen aus dem dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus zutage – darunter die ältesten Manuskripte, die wir von der Hebräischen Bibel überhaupt haben.
Immer noch Überraschungen, neue Fragmente, neue Debatten: Auch siebzig Jahre nach den ersten Funden erregen die Manuskripte von Qumran immer neues Interesse. Es war eine Ziege gewesen, mit der 1947 in der Judäischen Wüste alles angefangen hatte; auf der Suche nach ihr machte ein Hirte in einer Berghöhle nicht weit von Jericho die spektakulärste archäologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts. Er fand Schriftrollen aus dem Umfeld der Bibel. Ausgrabungen förderten bis 1956 in elf Höhlen die Überreste von 900 hebräischen Rollen aus dem dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus zutage – darunter die ältesten Manuskripte, die wir von der Hebräischen Bibel überhaupt haben.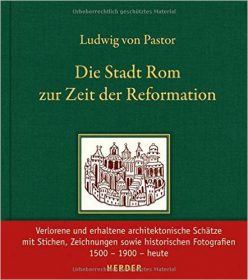 Einen besonders einnehmenden kleinen Band zur Stadtgeschichte Roms legt das Verlagshaus Herder neu auf. Das Besondere: es handelt sich um ein bereits 100 Jahre altes Buch, das versucht, in Wort und Bild das Rom der Reformation einzufangen. Eine doppelte historische Brechung also. Die aber ist umso reizvoller, als das Werk aus der Feder des betont katholischen Kirchenhistorikers Ludwig von Pastor (1854 – 1928) stammt, der sein wissenschaftliches Lebenswerk der Verteidigung der „una sancta“ in bester Tradition des ausgehenden 19. Jahrhunderts widmete.
Einen besonders einnehmenden kleinen Band zur Stadtgeschichte Roms legt das Verlagshaus Herder neu auf. Das Besondere: es handelt sich um ein bereits 100 Jahre altes Buch, das versucht, in Wort und Bild das Rom der Reformation einzufangen. Eine doppelte historische Brechung also. Die aber ist umso reizvoller, als das Werk aus der Feder des betont katholischen Kirchenhistorikers Ludwig von Pastor (1854 – 1928) stammt, der sein wissenschaftliches Lebenswerk der Verteidigung der „una sancta“ in bester Tradition des ausgehenden 19. Jahrhunderts widmete. „Gott ist barmherzig“ heißt das Büchlein, das der auf Kirche und Vatikan spezialisierte deutsche Historiker Ulrich Nersinger im Verlag media Maria vorgelegt hat. In acht Kapiteln durchläuft der geschichtlich hochversierte Journalist verschiedene Gegebenheiten der Heiligen Jahre, spricht über die Ursprünge, die Pilgerströme durch die Jahrhunderte, die Persönlichkeiten und die Heiligen der Jubeljahre. Beispiel: heilige Pforten. Woher und wozu? Und warum waren die heiligen Pforten beim ersten Heiligen Jahr 1300 noch nicht mit dabei? Ulrich Nersinger:
„Gott ist barmherzig“ heißt das Büchlein, das der auf Kirche und Vatikan spezialisierte deutsche Historiker Ulrich Nersinger im Verlag media Maria vorgelegt hat. In acht Kapiteln durchläuft der geschichtlich hochversierte Journalist verschiedene Gegebenheiten der Heiligen Jahre, spricht über die Ursprünge, die Pilgerströme durch die Jahrhunderte, die Persönlichkeiten und die Heiligen der Jubeljahre. Beispiel: heilige Pforten. Woher und wozu? Und warum waren die heiligen Pforten beim ersten Heiligen Jahr 1300 noch nicht mit dabei? Ulrich Nersinger: