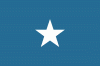 Zum ersten Mal wird an diesem Montag ein Welttag des Radios begangen – Gelegenheit, einmal auf seine fundamentale Rolle in armen Weltgegenden hinzuweisen. Beispiel: Somalia, der gescheiterte Staat. In seiner Hauptstadt Mogadischu sendet unter widrigsten Umständen Radio Shabelle. Fünf Mitarbeiter von Somalias einzigem unabhängigem Radio wurden in den letzten Monaten ermordet, der letzte war, am 28. Januar, sein Direktor Hassan Osman Abdi. Der 30-Jährige, Vater von drei Kindern, wurde vor seinem Haus von einem Killerkommando niedergestreckt.
Zum ersten Mal wird an diesem Montag ein Welttag des Radios begangen – Gelegenheit, einmal auf seine fundamentale Rolle in armen Weltgegenden hinzuweisen. Beispiel: Somalia, der gescheiterte Staat. In seiner Hauptstadt Mogadischu sendet unter widrigsten Umständen Radio Shabelle. Fünf Mitarbeiter von Somalias einzigem unabhängigem Radio wurden in den letzten Monaten ermordet, der letzte war, am 28. Januar, sein Direktor Hassan Osman Abdi. Der 30-Jährige, Vater von drei Kindern, wurde vor seinem Haus von einem Killerkommando niedergestreckt.
„Das war eindeutig eine Hinrichtung", sagt uns Radio-Shabelle-Vizedirektor Amiin Adow: „Die Bewaffneten sind ihm gefolgt, sie hatten es eindeutig auf ihn abgesehen, weil er unser Radio leitete. Wir wissen nicht, ob die Regierung Verdächtige für den Mord festgenommen hat, aber schon bei den zwei Direktoren vor ihm, die hingerichtet wurden, hat man nie einen Verantwortlichen gefunden oder gar bestraft. Es ist gefährlich für uns, in Somalia zu arbeiten, aber wir wollen weitermachen, weil uns das wichtig erscheint für unser Land, weil freie Medien zu einer demokratischen Gesellschaft gehören, weil einer auf die Gefahren hinweisen muss, die dem Land drohen. Man wird uns nie zum Schweigen bringen!"
Natürlich hat Adow Angst, das gibt er ohne weiteres zu. Aber „wir wollen uns den Luxus des Angsthabens nicht zu sehr erlauben", sagt er: „Keiner will sterben, aber die Aufgabe unseres Senders ist nun mal sehr wichtig."
„Wir werden eben vorsichtig sein. Natürlich wissen wir, dass Mogadischu vielleicht die gefährlichste Stadt der Welt für Journalisten überhaupt ist, aber wir wollen die Wahrheit senden, und darum machen wir trotz unserer Angst weiter. Unser Traum wäre etwas politische Hilfe aus dem Westen, vor allem eine Resolution, die Morde und Schikanen gegen somalische Medien anprangert. Wir stehen sehr unter Druck: Wegen der Shabab-Rebellen mussten wir unseren Sitz in Bakara-Market verlassen und haben dabei auch viel von unserer technischen Ausrüstung verloren, auch einige unserer besten Mitarbeiter."
Die Quellen von Radio Shabelle sind keine Nachrichtenagenturen, sondern Leute vor Ort:
„Wir haben Journalisten, die überall herumstreifen und nach Nachrichten suchen; wir sprechen mit den Opfern von Anschlägen, sie sind unsere wichtigste und erste Nachrichtenagentur, denn mit denen, von denen die Gewalt ausgeht, wollen wir nichts zu tun haben. Natürlich reden wir aber auch mit den örtlichen Funktionären und mit der Regierung; wichtig ist uns aber, dass wir in Somalia völlig unabhängig von allen sind."
Und wie finanziert sich das Ganze? „Gute Frage", sagt der Vize-Direktor. Das bisschen Werbung, das sein Sender spiele, bringe nicht besonders viel ein, aber müsse zum Leben reichen. Aus einem EU-Topf für den Aufbau freier Medien in Somalia habe er leider noch nichts bekommen. Wenigstens habe sein Sender sehr treue Hörer:
„Alle sind uns wirklich sehr dankbar für unsere Arbeit. Alle hören uns! Die Leute bleiben vor allem dran, weil sie wissen wollen, in welchem Teil Mogadischus sie sich gerade halbwegs sicher bewegen können und in welchem eher nicht. Wir decken jede Straße und jeden Stadtteil von Mogadischu ab. Aber natürlich bieten wir auch Unterhaltung: Entgegen den Anweisungen der Shabab senden wir Musik, das hält die Moral bei unseren Hörern hoch, und dafür lieben sie uns."
Er hoffe, dass man draußen in der Welt nicht denke, dass alle Somalier gewalttätig seien, sagt Amiin Adow. Die Menschen in Mogadischu seien in der Regel „effizient, gutmütig, sie wollen, dass das Land wieder auf eigenen Füßen läuft". Die internationale Gemeinschaft dürfe Somalia nicht im Stich lassen; sie jedenfalls von Radio Shabelle würden durchhalten.
„Wir haben viel Hoffnung! Auch in den Gipfel über Somalia, der am 23. Februar in London stattfinden wird. Wir sind davon überzeugt, dass diese Gewalt einmal aufhören wird!" (rv)

