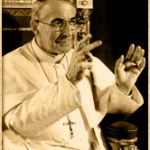Es waren Bilder, die an die Zeit der Apartheid erinnern: Die Polizei stürmt eine Mine, in der Arbeiter streiken. Auf beiden Seiten kommt es zu heftiger Gewalt. 34 Arbeiter sterben. Die Bilder aus der Platinmine von Marikana im Norden des Landes liessen in den letzten Tagen viele Südafrikaner an die sechziger Jahre denken: Damals – in der Zeit der Rassentrennung – kamen in der Stadt Sharpeville fast siebzig Menschen ums Leben. Präsident Jacob Zuma hat eine staatliche Untersuchung der Vorgänge in der Platinmine angeordnet; die Proteste in Minen und Stollen weiten sich aus. Am Donnerstag wurde in den Kirchen in ganz Südafrika mit Gottesdiensten an die Toten von Marikana erinnert. Kardinal Wilfried Fox Napier, der Erzbischof von Durban, sagte im Gespräch mit Radio Vatikan:
Es waren Bilder, die an die Zeit der Apartheid erinnern: Die Polizei stürmt eine Mine, in der Arbeiter streiken. Auf beiden Seiten kommt es zu heftiger Gewalt. 34 Arbeiter sterben. Die Bilder aus der Platinmine von Marikana im Norden des Landes liessen in den letzten Tagen viele Südafrikaner an die sechziger Jahre denken: Damals – in der Zeit der Rassentrennung – kamen in der Stadt Sharpeville fast siebzig Menschen ums Leben. Präsident Jacob Zuma hat eine staatliche Untersuchung der Vorgänge in der Platinmine angeordnet; die Proteste in Minen und Stollen weiten sich aus. Am Donnerstag wurde in den Kirchen in ganz Südafrika mit Gottesdiensten an die Toten von Marikana erinnert. Kardinal Wilfried Fox Napier, der Erzbischof von Durban, sagte im Gespräch mit Radio Vatikan:
„Was die Südafrikaner im Moment fühlen, kann man in zwei Worte fassen. Das erste ist Trauer oder Bestürzung über das Vorgefallene. Das zweite ist Schock: Schock, weil wir alle nie gedacht hätten, dass es soweit kommen könnte, dass unsere Sicherheitskräfte zu einer solchen Schießerei imstande sein könnten. Das erinnert wirklich an das Massaker von Sharpeville. Man sollte sich jetzt allerdings, was Marikana betrifft, mit Einschätzungen zurückhalten und erst einmal die Ergebnisse der staatlichen Untersuchungskommission abwarten. Dann werden wir erfahren, wie es zu dieser Eskalation kommen konnte. Jedenfalls hätten wir nicht mehr geglaubt, dass es jemals wieder solche Aktionen von Seiten der Polizei geben würde…"
Eines der „tiefgreifendsten Probleme in Südafrikas Gesellschaft" ist nach Ansicht des Erzbischofs von Durban, „dass in den Augen vieler Leute ein Menschenleben seine Bedeutung und seinen Wert verloren hat". Das Gemetzel in der Platinmine werfe aber vor allem ein Schlaglicht auf die schwierige Arbeit in den Minen. Die Kirche ist nach Auskunft von Kardinal Napier „sehr aktiv" im Einsatz für die Arbeiter:
„Ich glaube, dass es in jeder einzelnen unserer Diözesen und in jeder Pfarrei eine Art Lebensmittelhilfe-Programm für die Armen gibt, das auch Kleidung oder Hilfen anderer Art verteilt. Noch aktiver müssen wir wohl werden, wenn es um die Vermittlung bei Konflikten wie dem von Marikana geht. Allerdings wäre es da wahrscheinlich am hilfreichsten, wenn die Kirchen alle zusammen – oder vielleicht sogar alle Religionen zusammen – ihre Vermittlung anbieten würden, und nicht dass eine einzelne Kirche die Verantwortung für eine solche Vermittlung auf sich nimmt." (rv)