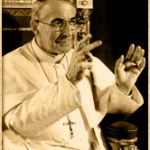 „Papst Johannes Paul I. wollte die Piusbruderschaft wieder in die römisch-katholische Kirche zurückholen." Das sagte der frühere Privatsekretär des 33-Tage-Papstes, Diego Lorenzi, im Gespräch mit einem katholischen italienischen TV-Sender. „Das Problem der Anhänger von Erzbischof Marcel Lefebvre, das auch heute noch auf der Tagesordnung steht, hat schon Johannes Paul I. sehr beschäftigt", so der Geistliche. „Die Einheit der Kirche lag dem Papst mehr am Herzen als alles, worüber die Presse so schrieb." Johannes Paul I., dessen hundertster Geburtstag in diesem Oktober begangen wird, war 1978 nur 33 Tage lang Papst. Zu seiner Zeit hatte Lefebvre noch nicht ohne Erlaubnis des Vatikans eigene Bischöfe geweiht, das tat er erst 1988. Die eigentliche schismatische Handlung war also noch nicht vollzog. Für Johannes Paul I. läuft ein Seligsprechungsverfahren; der Vize-Postulator dieses Verfahrens, Giorgio Lise, kündigt an, er werde der Seligenkongregation in Kürze die so genannte „Positio" übergeben. Darin werden die „heroischen Tugenden" Johannes Pauls I. detailliert aufgeführt und untersucht. Ein Wunder des Papstes sei bereits „prozedural anerkannt", so Lise. Er rechne mit einer Seligsprechung des Luciani-Papstes „in drei bis vier Jahren". (rv)
„Papst Johannes Paul I. wollte die Piusbruderschaft wieder in die römisch-katholische Kirche zurückholen." Das sagte der frühere Privatsekretär des 33-Tage-Papstes, Diego Lorenzi, im Gespräch mit einem katholischen italienischen TV-Sender. „Das Problem der Anhänger von Erzbischof Marcel Lefebvre, das auch heute noch auf der Tagesordnung steht, hat schon Johannes Paul I. sehr beschäftigt", so der Geistliche. „Die Einheit der Kirche lag dem Papst mehr am Herzen als alles, worüber die Presse so schrieb." Johannes Paul I., dessen hundertster Geburtstag in diesem Oktober begangen wird, war 1978 nur 33 Tage lang Papst. Zu seiner Zeit hatte Lefebvre noch nicht ohne Erlaubnis des Vatikans eigene Bischöfe geweiht, das tat er erst 1988. Die eigentliche schismatische Handlung war also noch nicht vollzog. Für Johannes Paul I. läuft ein Seligsprechungsverfahren; der Vize-Postulator dieses Verfahrens, Giorgio Lise, kündigt an, er werde der Seligenkongregation in Kürze die so genannte „Positio" übergeben. Darin werden die „heroischen Tugenden" Johannes Pauls I. detailliert aufgeführt und untersucht. Ein Wunder des Papstes sei bereits „prozedural anerkannt", so Lise. Er rechne mit einer Seligsprechung des Luciani-Papstes „in drei bis vier Jahren". (rv)
Monat: August 2012
Zypern/Türkei: Entweihte Kirchen
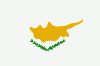 Metropolit Chrysostomos II. von Zypern klagt über die Entweihung christlicher Kirchen im türkisch besetzten Teil von Zypern. Viele Kirchen würden in diesem Teil der Insel in Lagerräume, Museen oder Moscheen umgewandelt, sagte das Oberhaupt der zyprisch-orthodoxen Kirche Anfang der Woche auf dem Katholikentreffen im italienischen Rimini. 120 Kirchen seien betroffen, die darin enthaltenen Kunstwerke seien beeinträchtigt bzw. verkauft worden. Der Metropolit beschwerte sich weiter über die Erhebung von Gebühren für Besucher des Grabes des Apostels Barnabas und anderer Heiliger Stätten des Christentums. Zyperns Bevölkerungsmehrheit gehört dem orthodoxen Christentum an, die zumeist türkischsprachigen Muslime machen etwa zwanzig Prozent aus. Nur jeweils ein Prozent der zyprischen Bevölkerung gehört der römisch-katholischen Kirche sowie den katholischen Maroniten an. Die für diese Christen zuständige Apostolische Nuntiatur wird vom Nuntius für das Heilige Land mitbetreut. (rv)
Metropolit Chrysostomos II. von Zypern klagt über die Entweihung christlicher Kirchen im türkisch besetzten Teil von Zypern. Viele Kirchen würden in diesem Teil der Insel in Lagerräume, Museen oder Moscheen umgewandelt, sagte das Oberhaupt der zyprisch-orthodoxen Kirche Anfang der Woche auf dem Katholikentreffen im italienischen Rimini. 120 Kirchen seien betroffen, die darin enthaltenen Kunstwerke seien beeinträchtigt bzw. verkauft worden. Der Metropolit beschwerte sich weiter über die Erhebung von Gebühren für Besucher des Grabes des Apostels Barnabas und anderer Heiliger Stätten des Christentums. Zyperns Bevölkerungsmehrheit gehört dem orthodoxen Christentum an, die zumeist türkischsprachigen Muslime machen etwa zwanzig Prozent aus. Nur jeweils ein Prozent der zyprischen Bevölkerung gehört der römisch-katholischen Kirche sowie den katholischen Maroniten an. Die für diese Christen zuständige Apostolische Nuntiatur wird vom Nuntius für das Heilige Land mitbetreut. (rv)
GB: Kardinal Murphy-O`Connor feiert 80. Geburtstag
 Der emeritierte Erzbischof von Westminster Cormac Kardinal Murphy-O`Connor feiert heute seinen 80. Geburtstag. Er wurde am 21.02.2001 durch Papst Johannes Paul II. in den Kardinalsstand erhoben und hat als Titelkirche "S. Maria sopra Minerva". Murphy-O`Connor ist Mitglied in mehreren Kongregationen und Päpstlichen Räten der Römischen Kurie. Mit seinem heutigen Geburtstag hat das Kardinalskollegium noch 118 wahlberechtigte Purpurträger und insgesamt umfasst es 207 Kardinäle. (vh)
Der emeritierte Erzbischof von Westminster Cormac Kardinal Murphy-O`Connor feiert heute seinen 80. Geburtstag. Er wurde am 21.02.2001 durch Papst Johannes Paul II. in den Kardinalsstand erhoben und hat als Titelkirche "S. Maria sopra Minerva". Murphy-O`Connor ist Mitglied in mehreren Kongregationen und Päpstlichen Räten der Römischen Kurie. Mit seinem heutigen Geburtstag hat das Kardinalskollegium noch 118 wahlberechtigte Purpurträger und insgesamt umfasst es 207 Kardinäle. (vh)
Libanon: „Papst kommt für alle“
 Die katholische Kirche erwartet sich vom Besuch Papst Benedikts XVI. einen „libanesischen Frühling". „Wir hoffen und beten, dass dieser Besuch zu einem wirklichen Frühling für den Libanon und die Region wird, für Christen und Muslime". Das sagte der Leiter des Vorbereitungskomitees, Bischof Camille Zaidan, laut der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Jounieh. Zaidan wies Mutmaßungen zurück, die Papstreise könne wegen der Sicherheitslage verschoben werden. Angesichts der Erschütterungen in der Region halte Benedikt XVI. umso beharrlicher an seinem Reiseplan fest, sagte der Bischof. Wenn der Papst vom 14. bis 16. September den Libanon besucht, kommt er für alle Libanesen, Christen wie Muslime, unterstrich Zaidan weiter. Zudem würden zahlreiche Besucher aus den Nachbarländern zu dem Besuch in Beirut erwartet. Am Mittwoch wurde im Libanon auch die Medien- und Werbekampagne zum Papstbesuch lanciert. Die Vereinten Nationen zeigten sich derweil beunruhigt über die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten in dem Land in Folge der Syrien-Krise. Die Situation in Syrien verschlechtere sich, was die Lage auch auf libanesischem Boden zunehmend prekärer werden lasse, sagte der Untersekretär für politische Angelegenheiten in der UNO, Jeffrey Feltman, in New York. (rv)
Die katholische Kirche erwartet sich vom Besuch Papst Benedikts XVI. einen „libanesischen Frühling". „Wir hoffen und beten, dass dieser Besuch zu einem wirklichen Frühling für den Libanon und die Region wird, für Christen und Muslime". Das sagte der Leiter des Vorbereitungskomitees, Bischof Camille Zaidan, laut der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Jounieh. Zaidan wies Mutmaßungen zurück, die Papstreise könne wegen der Sicherheitslage verschoben werden. Angesichts der Erschütterungen in der Region halte Benedikt XVI. umso beharrlicher an seinem Reiseplan fest, sagte der Bischof. Wenn der Papst vom 14. bis 16. September den Libanon besucht, kommt er für alle Libanesen, Christen wie Muslime, unterstrich Zaidan weiter. Zudem würden zahlreiche Besucher aus den Nachbarländern zu dem Besuch in Beirut erwartet. Am Mittwoch wurde im Libanon auch die Medien- und Werbekampagne zum Papstbesuch lanciert. Die Vereinten Nationen zeigten sich derweil beunruhigt über die Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten in dem Land in Folge der Syrien-Krise. Die Situation in Syrien verschlechtere sich, was die Lage auch auf libanesischem Boden zunehmend prekärer werden lasse, sagte der Untersekretär für politische Angelegenheiten in der UNO, Jeffrey Feltman, in New York. (rv)
Taiwan: Kardinal Shan Kuo-hsi J.S. verstorben
 Paul Kardinal Shan Kuo-hsi ist heute im Alter von 88 Jahren in Neu-Taipeh verstorben. Bis Januar 2006 leitete er das Bistum Kaohsiung. Shan Kuo-hsi wurde am 21.02.1998 durch Papst Johannes Paul II. in den Kardinalsstand erhoben und hatte die Titelkirche S. Crisogono. Mit seinem Tod umfasst das Kardinalskollegium 207 Purpurträger. Ein aktives Wahlrecht bei einem künftigen Konklave haben derzeit 119 Kardinäle. (vh)
Paul Kardinal Shan Kuo-hsi ist heute im Alter von 88 Jahren in Neu-Taipeh verstorben. Bis Januar 2006 leitete er das Bistum Kaohsiung. Shan Kuo-hsi wurde am 21.02.1998 durch Papst Johannes Paul II. in den Kardinalsstand erhoben und hatte die Titelkirche S. Crisogono. Mit seinem Tod umfasst das Kardinalskollegium 207 Purpurträger. Ein aktives Wahlrecht bei einem künftigen Konklave haben derzeit 119 Kardinäle. (vh)
Syrien: Nuntius gegen Weggang der UNO-Beobachter
 Der Umgang mit den Menschenrechten in Syrien wird von Tag zu Tag schlimmer. Das sagt der Vatikanvertreter in Damaskus, Erzbischof Mario Zenari, im Interview mit Radio Vatikan. Es seien von allen Seiten viele Fehler begangenen worden, so der Apostolische Nuntius weiter. Besonders der Weggang der UNO-Beobachter nach dem Auslaufen ihres Mandats am letzten Wochenende sei eine große Enttäuschung.
Der Umgang mit den Menschenrechten in Syrien wird von Tag zu Tag schlimmer. Das sagt der Vatikanvertreter in Damaskus, Erzbischof Mario Zenari, im Interview mit Radio Vatikan. Es seien von allen Seiten viele Fehler begangenen worden, so der Apostolische Nuntius weiter. Besonders der Weggang der UNO-Beobachter nach dem Auslaufen ihres Mandats am letzten Wochenende sei eine große Enttäuschung.
„Vor drei oder vier Monaten gab es die Hoffnung, dass durch die Anwesenheit der UNO-Beobachter die Gewaltwelle gestoppt werde. Es kam anders. Die internationale Staatengemeinschaft darf aber die Syrer nicht alleine lassen! Neue Hoffnung haben wir mit dem neuen UNO-Beauftragten für Syrien."
Die syrischen Regimegegner sind allerdings skeptisch gegenüber dem neuen UNO-Vermittler, dem Algerier Lakhdar Brahimi. Der Einsatz des 78-jährigen Diplomaten dürfe nicht zu einem weiteren „Deckmantel" für die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft werden, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung des Rates der Führung der Revolution in Damaskus. Die Regierung von Präsident Baschar al-Assad begrüßt hingegen die Mission Brahimis.
Vernehmlichem russischem Grollen zum Trotz hat US-Präsident Barack Obama – erstmals – von der Möglichkeit einer Militärintervention in Syrien gesprochen. Sollte Syrien den Einsatz chemischer Waffen vorbereiten oder tatsächlich einsetzen, werde eine „rote Linie" überschritten. Nuntius Zenari dazu:
„Es ist nicht meine Aufgabe, auf das, was Obama gesagt hat, einzugehen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass alle Konfliktparteien sich an die internationalen Menschenrechte halten. Dass es bisher nicht geklappt hat, liegt daran, dass alle Seiten Stück für Stück diese Rechte missachtet haben. … Erfreulich ist, dass die christlichen Gemeinschaften sich weiterhin für den Dialog einsetzen. Sie sind ein schönes Beispiel für uns alle." (rv)
Nigeria: Wachsender Islam und christliche Laxheit
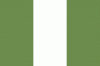 Die politischen und die religiösen Probleme in Nigeria sind nicht voneinander zu trennen, sie überkreuzen sich. Das sagt Bischof Ignatius Kaigama von Jos im Interview mit Radio Vatikan. Der Bürgerkrieg mit den Boko Haram schaffe ein riesiges Problem für das Land, aber man dürfe die Krise nicht zu vereinfacht betrachten.
Die politischen und die religiösen Probleme in Nigeria sind nicht voneinander zu trennen, sie überkreuzen sich. Das sagt Bischof Ignatius Kaigama von Jos im Interview mit Radio Vatikan. Der Bürgerkrieg mit den Boko Haram schaffe ein riesiges Problem für das Land, aber man dürfe die Krise nicht zu vereinfacht betrachten.
„Es ist ein Fehler, jede Krise in Nigeria auf Religion zu reduzieren. Es gibt soziale, politische und ökonomische Fragen, es gibt die Probleme der nachwachsenden Generation; all das löst Krisen aus. Irgendwie wird daraus dann eine Krise zwischen Muslimen und Christen. Ich bestehe darauf, dass es eine Trennung gibt: Ja, es gibt religiöse Interessen, aber die sind nicht für die gesamte Krise verantwortlich. Manchmal gehen wir nicht weit genug in unserer Suche nach den wirklichen Wurzeln des Problems. Ich gebe zu, es gibt religiöse Probleme. Es gibt religiöse Spannung, aber wir befinden uns nicht im Krieg zwischen Christen und Muslimen."
Diesen Krieg führe allein die Boko Haram, sie wolle einen islamistischen Staat, aber diese Gruppe dürfe man auf keinen Fall mit dem gesamten Islam identifizieren, so Kaigama, dessen Bistum im Zentrum des Landes und damit an der Grenze zwischen dem relativ ruhigen Süden und den Unruhegebieten im Norden liegt. Die Regierung und die Sicherheitsbehörden scheinen der Gewalt hilflos gegenüber zu stehen. Und da Sicherheit nicht gewährleistet werden könne, gebe es Angst.
„Es könnte entweder zu einem offenen religiösen Konflikt oder zu einem Bürgerkrieg des Nordens gegen den Süden bzw. des Südens gegen den Norden kommen. Wenn das geschieht, dann werden unvermeidlich auch andere Teile Westafrikas in Mitleidenschaft gezogen, schließlich ganz Afrika. Wir wollen also keinen Krieg in Nigeria!"
Man hoffe auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft, um die Situation friedlich lösen zu können. Und im Augenblick seien es gerade die Christen, die unter der Krise besonders litten.
„Es ist ein Kampf ums Überleben für die Christen. Denken Sie nur an Nordafrika, das einmal sehr christlich war. Jetzt wachen wir auf und sehen die Christen in der Minderheit. Die islamischen Gemeinschaften haben Energie und tun alles, um ihren Glauben zu verbreiten und ihre eigene Religion zu beschützen. Wir Christen hingegen – sowohl in Afrika wie auch im Westen – halten uns zurück und sind manchmal sogar die schärfsten Kritiker des Christentums. Ehemals christliche Länder können Sie sagen hören, dass man jetzt in einer nach-christlichen Ära lebe. Der Islam weitet sich aus, und zwar in den verschiedensten Ländern Europas. Und auch in Afrika: In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es keine Muslime – und jetzt steht dort eine Moschee. Es gibt eine phänomenale Ausdehnung auf Kosten der Christen, die dem nur Laxheit in der Praxis des Glaubens entgegenzusetzen haben." (rv)
Fokus: Christenverfolgung „im Namen Allahs“?
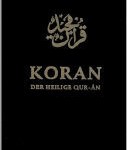 Sie ist elf, behindert und soll Gott gelästert haben: In Pakistan ist in der vergangenen Woche ein Mädchen mit Down-Syndrom verhaftet worden, weil sie Seiten eines Koran-Lesebuches verbrannt haben soll. Blasphemie, so der Vorwurf gegen das Kind, das nun einem Richter vorgeführt werden soll. Die Verfolgung von Christen in muslimischen Ländern hat sich dramatisch entwickelt, sagt die Aachener Islamwissenschaftlerin Rita Breuer: Gewaltsame Übergriffe gegen Gläubige, Kirchen, christliche Symbole, Wohnhäuser und Geschäfte von Christen in Pakistan, Saudi-Arabien, Afghanistan, Iran, Nigeria und auf den Malediven stellten aber nur die Spitze des Eisbergs dar, betont die Autorin des Buches „Im Namen Allahs? Christenverfolgung im Islam?" im Interview mit dem Domradio Köln. Denn daneben gebe es viele rechtliche und politische Benachteiligungen von Christen. Breuer:
Sie ist elf, behindert und soll Gott gelästert haben: In Pakistan ist in der vergangenen Woche ein Mädchen mit Down-Syndrom verhaftet worden, weil sie Seiten eines Koran-Lesebuches verbrannt haben soll. Blasphemie, so der Vorwurf gegen das Kind, das nun einem Richter vorgeführt werden soll. Die Verfolgung von Christen in muslimischen Ländern hat sich dramatisch entwickelt, sagt die Aachener Islamwissenschaftlerin Rita Breuer: Gewaltsame Übergriffe gegen Gläubige, Kirchen, christliche Symbole, Wohnhäuser und Geschäfte von Christen in Pakistan, Saudi-Arabien, Afghanistan, Iran, Nigeria und auf den Malediven stellten aber nur die Spitze des Eisbergs dar, betont die Autorin des Buches „Im Namen Allahs? Christenverfolgung im Islam?" im Interview mit dem Domradio Köln. Denn daneben gebe es viele rechtliche und politische Benachteiligungen von Christen. Breuer:
„Überall da, wo der Islam einfach als Staatsreligion eine privilegierte Stellung hat und auch das Rechtssystem weitgehend prägt, kommt es automatisch dazu, dass andere Religionsgemeinschaften – so auch die Christen – weniger privilegiert sind. Das heißt, sie dürfen bestimmte Staatsämter nicht ausüben, sie dürfen nicht Richter werden, sie dürfen manchmal bestimmte Berufe nicht ergreifen."
Das ist zum Beispiel in Ägypten der Fall, wo Verwaltung und Regierung nahezu vollständig „christenfrei" sind. In Indonesien haben Christen zum Beispiel immer wieder Probleme mit Proselytismus-Vorwürfen und beim Bau von Kirchen.
„Was die Religionsausübung angeht: Die soll eigentlich geschützt sein, aber es ist in der Tat so, dass es da gerade wenn es um den Bau von Kirchen geht, um den Unterhalt christlicher Gebäude, viele behördliche Schikanen gibt. Dass man den Christen immer wieder unterstellt, sie wollten missionieren, sie wollten die Muslime von ihrer Religion abbringen. Also, auch die Religionsausübung wird sehr eingeschränkt. Ganz besonders gilt das in der Tat für jede Form von Mission, und damit ist auch eine besonders schwierige Situation der Konvertiten vom Islam zum Christentum verbunden."
In Saudi-Arabien sei die Lage der Christen immer noch am schlimmsten.
„Das trägt geradezu phobische Züge dort, die Angst vor dem Christentum! Da ist wirklich jede nichtislamische Religionsausübung verboten. Man darf noch nicht einmal ein Kreuz an der Kette haben, keine Bibel zum persönlichen Gebrauch mit sich führen. Es ist auch jede pastorale Versorgung der vielen christlichen Gastarbeiter im Land völlig unmöglich, etwa von den Philippinen. Das ist das Schlimmste, was die Bandbreite zu bieten hat."
Freilich gebe es auch liberale Muslime, die Christen schätzten und schützten, so Breuer. Allerdings werde es in der „momentanen Phase, in der der politische Islam sehr erstarkt, einflussreich wird und auch international unterstützt wird", zunehmend schwer, sich Gehör zu verschaffen. Positives Beispiel für ein tolerantes, muslimisches Land sei das afrikanische Gambia.
„Das ist das einzige Land mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung, in dem es überhaupt keine religiöse Diskriminierung gibt. Das liegt einfach an dem säkularen Staatswesen. Dort gibt es keine Staatsreligion. Insofern sind alle Religionsgemeinschaften de jure, aber auch de facto gleichberechtigt. Es gibt natürlich andere Länder, wo entweder einfach ein liberalerer Islam gelebt wird oder auch die Herrscher jeweils die Christen als Allianzpartner gegen den Islamismus ansehen. Das ist zum Beispiel in Jordanien der Fall, das ist in Marokko der Fall, das war bzw. ist in Syrien der Fall, da weiß man momentan nicht, wie sich die Dinge entwickeln."
Verfolgung „im Namen Allahs" – so rechtfertigen extremistische Muslime oft die Verfolgung Andersgläubiger. Doch gibt es Hinweise im Koran, die eine Andersbehandlung anderer Religionen rechtfertigen würden? Dazu meint Breuer:
„Der Koran bezeichnet die Christen als Leute des Buches, als Empfänger einer göttlichen Offenbarung, die grundsätzlich zu achten sind, die aber den Muslimen moralisch-theologisch unterlegen sind . Der Islam ist die letzte und beste Religion, so sagt es der Koran. Damit ist letztlich auch gegeben, dass die Christen in islamischen Staaten untergeordnete Positionen einnehmen und die Muslime letztlich das Sagen haben. Insofern gibt es schon eine koranische Grundlegung für die Ungleichbehandlung – nicht für die Verfolgung, die wir jetzt vielerorts sehen, und für die gewaltsamen Übergriffe."
Extremisten gäben sich hier die Losung: „Christen sind Ungläubige, und Ungläubige müssen bekämpft werden", so Breuer. Auf der anderen Seite setzten sich aber viele liberale Muslime für eine Anpassung des Islams ein, fügt die Expertin an. Sie wollten den Koran „ins 21. Jahrhundert übersetzen" und Christen als „ebenbürtig und gleichberechtigt" behandeln. (rv)
Südafrika: Die Toten in der Platinmine
 Eine „schockierende Eskalation der Gewalt": So nennen die Bischöfe von Südafrika das Massaker von Marikana. Über dreißig Menschen kamen dort am Donnerstag in einer Platinmine ums Leben, als die Polizei gegen Streikende vorging; fast achtzig Menschen wurden verletzt. Es war offenbar der blutigste Polizeieinsatz seit dem Ende der Apartheid in Südafrika im Jahr 1994. Die Polizisten verteidigen sich mit dem Hinweis, viele der Streikenden seien mit Macheten auf sie losgegangen. Im Lauf der Streikwoche sollen die Minenarbeiter zwei Polizisten totgeschlagen und einen Wachmann in seinem Auto lebendig verbrannt haben.
Eine „schockierende Eskalation der Gewalt": So nennen die Bischöfe von Südafrika das Massaker von Marikana. Über dreißig Menschen kamen dort am Donnerstag in einer Platinmine ums Leben, als die Polizei gegen Streikende vorging; fast achtzig Menschen wurden verletzt. Es war offenbar der blutigste Polizeieinsatz seit dem Ende der Apartheid in Südafrika im Jahr 1994. Die Polizisten verteidigen sich mit dem Hinweis, viele der Streikenden seien mit Macheten auf sie losgegangen. Im Lauf der Streikwoche sollen die Minenarbeiter zwei Polizisten totgeschlagen und einen Wachmann in seinem Auto lebendig verbrannt haben.
Der italienische Missionar Gianni Piccolboni arbeitet in der Nähe von Marikana. Im Gespräch mit Radio Vatikan erläuterte er die Hintergründe.
„Man kann schon sagen: Wo es Minen gibt, da ist die Lage fast immer katastrophal. Ich war vor kurzem mit dem Auto in der Gegend der Platinminen, mein Eindruck war: Zuviele Menschen auf einem Haufen und ohne Organisation. Da leben 30.000 Menschen weitab von jeder Stadt; das Förderunternehmen baut zwar angeblich einige Baracken für die Arbeiter, aber sowohl bei den Gold- wie bei den Silberminen haben sich in den letzten fünfzig Jahren unglaublich viele Konflikte, Unordnung und Kriminalität entwickelt. Diese Männer, die acht Stunden täglich unter Tage verbringen, sind nicht mehr dieselben, wenn sie abends rauskommen, sie sind nervös, ungeduldig. Sie fordern mit Recht ein Gehalt, das der Schwere ihrer Arbeit angemessen wäre, sie fühlen sich ihrer Rechte beraubt, gezwungen zu einem Leben unter unmenschlichen Umständen."
Die Meldungen von der Gewalt in Marikana haben viele Südafrikaner bestürzt: „Die Zeitbombe tickt nicht mehr, sie ist jetzt hochgegangen", urteilt eine Zeitung. Viele fühlen sich an die bleierne Zeit des Apartheid-Regimes erinnert.
„Die Apartheid zwischen Weißen und Schwarzen ist ja noch gar nicht richtig vorbei! Das wird noch viel Zeit brauchen. Zwar ändert sich vieles in Südafrika mit der Zeit zum Besseren, das Land ist auf einem interessanten Weg, aber den Krieg zwischen Armen und Reichen wird es hier immer geben. Und leider trägt in dieser Sache auch der Westen einen Teil der Verantwortung, denn von den großen Unternehmen, die in Südafrika investieren – Anglo American, De Beers – kommt ja keiner, um hier Sozialarbeit zu leisten: Die kommen, weil sie Interessen haben. Und diese Interessen lasten dann auf den Armen, das war immer schon so." (rv)
Versöhnung zwischen Polen und Russland: „Der erste und wichtigste Schritt“
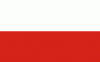
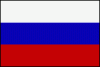 Es war eine feierliche Zeremonie im Warschauer Königsschloß: Die russisch-orthodoxe Kirche und die katholische Kirche Polens wollen sich und ihre Völker untereinander aussöhnen. Dazu unterzeichneten ihre Spitzenvertreter am Freitag Mittag in der polnischen Hauptstadt eine Gemeinsame Erklärung: „Botschaft der Versöhnung an die Gläubigen unserer Kirchen, an unsere Nationen und an alle Menschen guten Willens".
Es war eine feierliche Zeremonie im Warschauer Königsschloß: Die russisch-orthodoxe Kirche und die katholische Kirche Polens wollen sich und ihre Völker untereinander aussöhnen. Dazu unterzeichneten ihre Spitzenvertreter am Freitag Mittag in der polnischen Hauptstadt eine Gemeinsame Erklärung: „Botschaft der Versöhnung an die Gläubigen unserer Kirchen, an unsere Nationen und an alle Menschen guten Willens".
„Unsere Brüdervölker sind nicht nur durch ihre Nachbarschaft vereint, sondern auch durch ein reiches ost- und westkirchliches Erbe", betont der Text. Er bekennt sich zum „Weg eines ehrlichen Dialogs", um „die Wunden der Vergangenheit zu heilen". Für die russische Seite setzte der Moskauer orthodoxe Patriarch seine Unterschrift unter das Dokument; Kyrill I. hält sich derzeit – auch das schon ist eine Premiere – zu einem offiziellen Besuch in Polen auf. Für die polnische Seite unterzeichnete der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Józef Michalik, der die Initiative trotz mancher Kritik vom rechten Rand der polnischen Kirche durchgesetzt hat. „Das ist ein historischer Schritt für unsere beiden Völker", meinte Erzbischof Michalik in einer kurzen Ansprache. „Vielleicht sind einige perplex über diesen Schritt. Aber wir tun ihn im Geist des Evangeliums."
„Wir appellieren an unsere Gläubigen, um Verzeihung zu bitten für die Beleidigungen, die Ungerechtigkeiten und für alles gegenseitig angetane Unrecht", heißt es in der Gemeinsamen Erklärung. Und weiter: „Wir sind davon überzeugt, dass das der erste und wichtigste Schritt ist, um das gegenseitige Vertrauen wiederherzustellen, ohne das es keine dauerhafte menschliche Gemeinschaft und keine volle Versöhnung gibt." Vergebung bedeute nicht Vergessen; die „schwierigen und tragischen" Kapitel der russisch-polnischen Geschichte müssten von Historikern beider Seiten aufgearbeitet werden. „Wir sind davon überzeugt", so die beiden Kirchen, „dass eine dauerhafte Versöhnung als Fundament einer friedlichen Zukunft nur auf der Basis der vollen Wahrheit über unsere gemeinsame Vergangenheit möglich ist." Jeder Pole solle in jedem Russen, und jeder Russe in jedem Polen, „einen Freund und Bruder sehen".
Wie angekündigt gehen die Kirchen in ihrer Erklärung nicht auf die historischen Streitfragen zwischen Polen und Russland ein. Stattdessen beschreiben sie in dem Dokument ausführlich das gemeinsame Ziel, die christlichen Werte in der heutigen Zeit zu verteidigen. Kyrill I. hatte am Donnerstagabend bei einem Empfang am Sitz der katholischen Bischofskonferenz gesagt: „Überlassen wir die Geschichte den Historikern und das, was heute real ist, uns – den
Hirten." Beide Kirchen würden heute in ihren Ländern angegriffen. In Russland gebe es zunehmend eine antikirchliche Stimmung, unter anderem gegen den neuen Religionsunterricht in den Schulen. In Polens Parlament verlange eine Partei, das Kreuz aus dem Sitzungssaal zu entfernen.
Die polnisch-russischen Beziehungen sind unter anderem wegen der Rolle der Sowjetunion zu Beginn des Zweiten Weltkriegs und der Ermordung polnischer Kriegsgefangener bis heute belastet. Sowjetische Truppen hatten Polen zwar 1944/45 von den deutschen Besatzern befreit, dem Land aber ein moskautreues Regime aufgezwungen. Russische Historiker wiederum machen Warschau für den Tod Tausender sowjetischer Kriegsgefangener während des polnisch-sowjetischen Kriegs Anfang der 1920er Jahre verantwortlich.
Der Vorsitzende der Polnischen Bischofskonferenz, Erzbischof Jozef Michalik, hatte am Donnerstag erklärt, die Versöhnungserklärung habe keinen politischen Charakter. Es handele sich um ein ausschließlich religiöses Dokument. „Das ist ein seelsorgerischer Akt", so Michalik. Die russisch-orthodoxe Kirche ist mit rund 150 Millionen Mitgliedern die mit Abstand größte orthodoxe Nationalkirche. Sie zählt fast alle ehemaligen Sowjetrepubliken zu ihrem Territorium. In Polen hat die katholische Kirche traditionell großen Einfluss. Mehr als 95 Prozent aller Bürger des Landes sind katholisch getauft. Etwa 400.000 der mehr als 38 Millionen Polen sind orthodox. (rv)

